
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenMehr Digitalisierung könnte die Forschung zu Seltenen Erkrankungen revolutionieren
Wenn es einen Ort gibt, an dem der Tag mehr als 24 Stunden haben müsste, dann sind es Uni-Kliniken. Die MedizinerInnen dieser Einrichtungen befinden sich dauerhaft im Dilemma: Sie sollen Patienten versorgen, Studierende ausbilden und im Idealfall auch noch forschen. Dieser Spagat in drei Richtungen funktioniert nur in den wenigsten Fällen. Was auf der Strecke bleibt, ist häufig die Forschung.
Clinician oder Physician Scientist Programme versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Sie kaufen Ärzte und Ärztinnen für einen bestimmten Zeitraum vom Klinikalltag frei, damit diese sich voll und ganz auf vielversprechende Forschungsprojekte konzentrieren können. Dr. Wolfgang Merkt ist Physician Scientist am Universitätsklinikum Heidelberg. Durch ein von der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung finanziertes Stipendium konnte sich der Rheumatologe zwei Jahre lang auf die Erforschung von Morbus Wegener (auch: Wegener Granulomatose (GPA)) konzentrieren, einer entzündlichen Erkrankung der Blutgefäße, die tödlich enden kann.
„Man braucht fürs Forschen viel – in allererster Linie aber Zeit und Geld“, sagt Merkt. „Jedes Projekt benötigt Vorarbeit. Ich muss mich einlesen, muss Kooperationen knüpfen, Patienten sammeln, Doktoranden einarbeiten. Dann muss ich das Projekt selber durchführen und zu den Resultaten eine Statistik machen. Mit anderen Worten: Es braucht eine Menge, um da in die Tiefe zu gehen.“
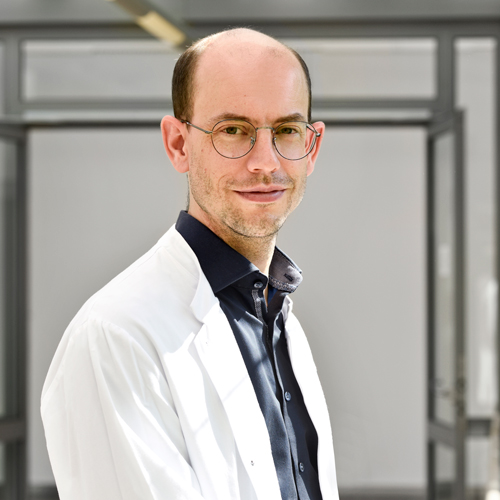
Zeit ist das eine kostbare Gut, Patientendaten sind das andere. Gerade bei Seltenen Erkrankungen besteht das Problem darin, überhaupt Material von einer Gruppe zu erfassen, die statistisch gesehen tragfähig ist, aus der sich allgemeingültige Ergebnisse ablesen lassen. Von der Autoimmunerkrankung GPA, Merkts Forschungsschwerpunkt, sind in Deutschland zurzeit mehr als zehntausend Personen betroffen – und damit wesentlich mehr als von vielen anderen seltenen Krankheiten. Über die Uniklinik Heidelberg hat er Zugang zu etwa hundert Patienten: „Wir sind als Zentrum relativ gut aufgestellt, dennoch kratzen wir an der Untergrenze dessen, was man eigentlich braucht“, sagt der Mediziner. Die Lösung? „Das Wichtige bei seltenen Krankheiten ist, dass man sich gut vernetzt, dass man seine Daten zusammenlegt.“
Aber selbst bei guter Kooperation sind den Forschenden aufgrund fehlender Digitalisierung und strengen Datenschutzes häufig die Hände gebunden. So fiebert Merkt zum Beispiel der digitalen Patientenakte entgegen: „Jeder Patient hat schon irgendwelche Voruntersuchungen gehabt. All diese Daten würden mir extrem helfen, um zu bewerten, in welche Richtung es eigentlich geht. Aber sie liegen mir nicht vor. Da geht sehr viel Wissen verloren, wenn der Patient die Behandelnden oder das Krankenhaus wechselt.“
Ein nächster Schritt wäre die Möglichkeit, klinische Ergebnisse mit Laborwerten zu verknüpfen. So kann man ganz neue Muster entdecken, ist sich Merkt sicher. Gerade von der effizienteren Erfassung und Auswertung von Daten erwartet der Forscher in Zukunft „eine kleine Revolution“. Immer in Abwägung mit dem Datenschutz, natürlich, der aber für den Mediziner auch die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Blick haben muss: „Wir brauchen nicht nur Datenschutz, wir brauchen auch Patientenschutz“, sagt Merkt. Er ist überzeugt: „Wir können den Menschen nur helfen, wenn wir über die Forschung ihre Erkrankung verstehen. Nur so lassen sich neue Medikamente oder zumindest neue Strategien entwickeln.“



